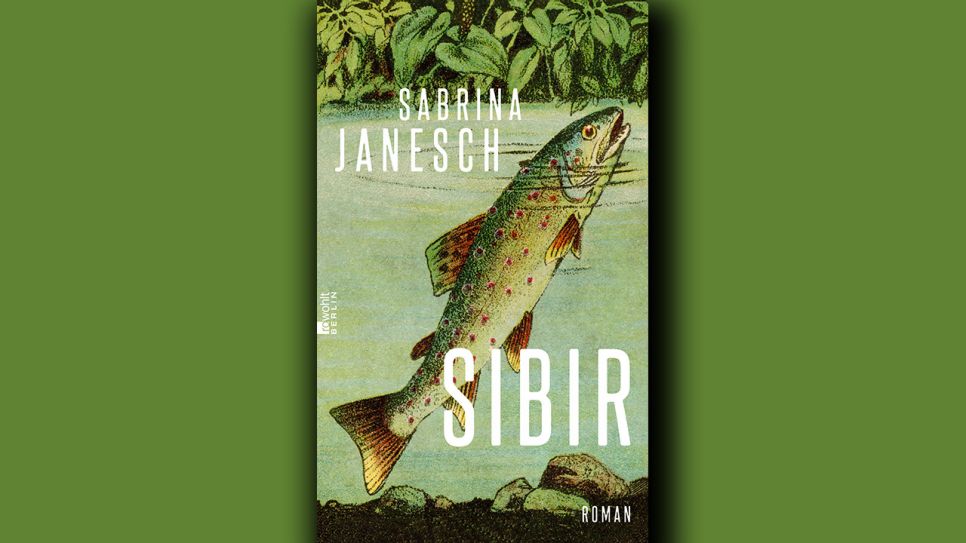Roman - Sabrina Janesch: "Sibir"
In der Steppe, in der Heide: Sabrina Janesch erzählt anhand von zwei Kindheiten von Familientraumata und Generationenerbe. Es ist ein starker Roman über Familie und Freundschaften, die Auswirkungen von Erinnerungen auf das eigene Leben und das der nachfolgenden Generationen – und die wichtige Frage, wie man mit Neuankömmlingen umgeht.
Am Anfang des Romans steht das Vergessen und – dem entgegengesetzt – der Drang, etwas festzuhalten. Der Vater ist an Demenz erkrankt, die Mutter ruft Leila, die Tochter an und bittet sie zu kommen. Seine Tagebücher hat er vernichtet, und es mache ihn "todtraurig", nichts mehr zu wissen. "Das hat er anscheinend nicht vergessen", sagt die Mutter, "dass er vergessen wollte. Jetzt hat er vergessen und erträgt es nicht."
Also reist Leila an. Um zu begleiten. Und um sich für ihn zu erinnern. Das Vergessen der älteren Generation und das Festhalten der jüngeren – ein starker Erzählmotor, um Bücher zu schreiben, u.a. bei Arno Geiger, David Wagner oder Saša Stanišić. Genauso bei Sabrina Janesch: "Also schön, denke ich, alles schriftlich festhalten, etwas zusammensetzen, Stein um Stein, zu einem Gehäuse, in das man sich zurückziehen oder das man für immer hinter sich lassen kann."
Das Gehäuse, das Janesch daraus gemacht hat, ist ein dicht gewebter Roman über zwei Kindheiten, die 40 Jahre trennen, und die dennoch viel gemeinsam haben.
Schon in ihren ersten Büchern hat sich die Autorin auf die Spuren ihrer deutsch-polnischen Familien begeben. In "Sibir" nimmt sie sich nun die Geschichte ihres Vaters vor, der als Kind mit seiner Familie nach Sibirien verschleppt wurde. Er nennt es die "die schwarze Stunde" – der Moment, als 1945 russische Soldaten an die Tür klopften und die Familie – ursprünglich aus Galizien - in einen Zug setzten, in Richtung Sibirien.
Gelungenes Wagnis
Es ist ein Wagnis, in die Figur eines Jungen zu schlüpfen, der dem eigenen Vater ähnelt. Sabrina Janesch ist dieses Wagnis gelungen. Ein Junge, der im Zug sitzt und Strohsterne bastelt. Ein Junge, dessen kleiner Bruder auf der langen Fahrt stirbt und dessen Mutter vollkommen verzweifelt in einen Schneesturm geht und niemals wiederkehrt. Ein Junge, der im Dorf in der Steppe eine Freundschaft knüpft – ausgerechnet zu einem kasachischen Jungen, Tachawi.
"Sibir" ist ein Vaterbuch, und dem hat Janesch es auch gewidmet. Auf Deutsch, Russisch und Kasachisch. Gleichzeitig erzählt sie von der eigenen Kindheit in einem niedersächsischen Dorf, in dem sie in einer Siedlung mit Sonderlingen und Eigenbrötlern aufwächst – den Rückkehrern. Menschen mit Schlafstörungen, seltsamen Ticks und dem Drang, alles zu horten.
Die Kinder basteln sich ihre eigene Welt, geprägt von den Traumatisierungen ihrer Eltern. Sie bauen unzählige Hütten, in denen sie Lebensmittel horten. Und sie tragen die Last der Eltern mit. Als Leila in der zweiten Klasse ist und der Vater bei einem Treffen aus dem Fenster springt, als es an der Tür klopft, erklärt das Kind den anderen: "Mein Papa erschrickt sich leicht. Er ist als Kind mit seiner Familie nach Sibirien verschleppt worden."
Ein starker Roman
Kunstvoll verwebt Janesch die Erzählstränge miteinander. Zwei Kindheiten, eine in der Steppe, eine in der Heide. Kindheiten mit Freundschaften und langen Sommern. Und wenn Janesch ein Kapitel in der kasachischen Steppe mit den Sätzen "Wer sind Sie? Was wollen sie?" enden lässt, beginnt das nächste Kapitel in Niedersachsen mit der Frage "Wer sind die? Was wollen die?". Die Vertriebenen aus dem Jahr 1945, die in der Siedlung in der Steppe vor einer verschlossenen Tür stehen, sind in "Sibir" nur eine Seite entfernt von den Spätaussiedlern, die Anfang der 1990er Jahre im niedersächsischem Dorf ankommen – und dort von Leilas Vater herzlich empfangen werden.
Ein starker Roman über Familie und Freundschaften, die Auswirkungen von Erinnerungen auf das eigene Leben und das der nachfolgenden Generationen – und die wichtige Frage, wie man mit Neuankömmlingen umgeht.
Anne-Dore Krohn, rbbKultur